Bücherbriefing
Klima und (immer noch) Pandemie – das sind die großen, länderübergreifenden Krisen, die die Welt auch dieses Jahr in Atem gehalten haben. Darüber hinaus sind es einzelne Länder, die bewegten: Mindestens Ukraine, Russland, Iran, China, USA, Großbritannien, Katar, Ungarn, Polen, Italien, Schweden. Die von hier ausgehenden Konflikte trafen insbesondere in Deutschland auf eine (intellektuelle) Öffentlichkeit, die sich mit den Folgen von Neoliberalismus und Populismus auseinanderzusetzen hat. Die einen sehen überall „woke“ Intoleranz und Cancel Culture, andere halten das für einen großen Popanz. Immer wieder geht es dabei um Sprache und um kulturelle Codes. Dort, wo Denkmäler gestürzt und Bilder gestürmt (oder mit Suppe überschüttet?) werden, gerät verstärkt der Kolonialismus in den Blick. Dass sich nun der Postkolonialismus ausgerechnet am Stellenwert des Holocaust abarbeitet, hat nicht zuletzt der Skandal der diesjährigen Documenta gezeigt: Nie seit 1945 wurden derart unverhohlen antisemitische Machwerke in der Öffentlichkeit gezeigt – ein beispielloses Versagen aller Beteiligten. Bei all dem macht die Rede von der gespaltenen Gesellschaft die Runde, was auf den ersten Blick plausibel erscheint, auf den zweiten aber schon nicht mehr. Oft ist die Lage insbesondere in Deutschland besser als die Stimmung. Beziehungsweise anders: Die Lage ist zwar nicht mehr so rosig, aber längst nicht aus den Gründen, die gemeinhin dafür angeführt werden. It’s complicated. Und bei einer derart bewegten Gegenwart, bei so viel Weltgeschichte, die sich nach relativ ruhigen Jahren wieder zu verdichten scheint, gerät die ferne Vergangenheit schon mal aus dem Blick. Dabei gilt im Westen unverändert: Alle Wege führen nach Rom. Dort, wo Amtsdiener einst Rutenbündel („fasces“) vor den Staatsherren hertrugen, regiert heute wieder eine Faschistin. Dass eine solch „interessante“ Zeit hervorragende Sachbücher hervorbringt, mag wie Fluch und Segen scheinen.
Zu den Titeln
Sabine Adler: Die Ukraine und wir. Deutschlands Versagen und die Lehren für die Zukunft

Der Titel sagt bereits alles: Warum muss dieser Krieg gerade Deutschland „interessieren“, was wurde in der Vergangenheit alles versäumt, wie viel aus heutiger Sicht Haarsträubendes wurde über die Ukraine erzählt und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? All das erklärt Sabine Adler gut lesbar und meinungsstark.
Jessikka Aro: Putins Armee der Trolle. Der Informationskrieg des Kreml gegen die demokratische Welt
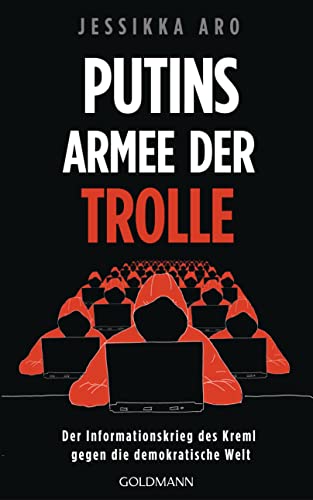
Von den St. Petersburger Trollfabriken wird mittlerweile jede:r schon mal gehört haben. Doch wenn man so tief in diese Halbwelt hinabsteigt, wie es die finnische Journalistin Jessikka Aro verdienstvoller Weise getan hat, kann einem schon ganz anders werden. Dass der Westen diesen konzertierten Angriff auf seine Öffentlichkeit so lange hat geschehen lassen, muss doch schwer verwundern.
Golineh Atai: Iran. Die Freiheit ist weiblich

Streng genommen nichts für diese Liste, denn das Buch ist aus dem letzten Jahr. Doch die Realität hat den Band von Golineh Atai in die Gegenwart geholt: „Frauen, Leben, Freiheit“ ist die Losung der Iran-Proteste gegen das Mullah-Regime, die im September durch den Mord an der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini ausgelöst wurden – und die hoffentlich mit einem freien Iran enden.
Stefan Aust / Adrian Geiges: Xi Jingping. Der mächtigste Mann der Welt

Anfang des Jahres dürften sich hierzulande noch vergleichsweise wenige Menschen mit dem chinesischen Staatspräsidenten, Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission und Generalsekretär der Kommunistischen Partei auseinandergesetzt haben. Das dürfte sich mittlerweile geändert haben: Durch dessen Machtzuwachs und durch das Beispiel Russlands. Autoritäre Handelspartner, die ein Nachbarland mit Krieg bedrohen, können – wie man spätestens jetzt lernen musste – einen ziemlichen Einfluss auf unseren Alltag haben. Einen guten Einstieg bietet dieses sehr gut lesbare und informative Buch.
Anita Blasberg: Der Verlust. Warum nicht nur meiner Mutter das Vertrauen in unser Land abhandenkam

Ein Buch über vieles. Vor allem über einen Stimmungswandel. Ein Stück deutsche Gesellschafts-, Wirtschafts-, Sozial-, und Mentalitätsgeschichte. Auch ein sehr persönliches Buch. Die Mutter der Autorin ist keine entrückte „Querdenkerin“, aber vollkommen enttäuscht und desillusioniert, was das politische „System“ angeht. Das ist zwar in einem Land wie Deutschland immer noch ein Jammern auf ziemlich hohem Niveau, doch was Blasberg aus den letzten dreißig Jahren alles hervorholt und erlebbar macht, liest sich dennoch ziemlich triftig. Marxisten würden wohl von einem Angriff des Großkapitals sprechen. Allen anderen fehlt derweil die Sprache, was mitunter zu einiger Verwirrung führt.
György Dalos: Das System Orban. Die autoritäre Verwandlung Ungarns

Dass es schlimm ist, war irgendwie klar. Aber wie schlimm es ist, zeigt sich nach der Lektüre dieser Studie. Es handelt sich dabei nicht um eine ungarische Geschichte der letzten Jahre und Jahrzehnte, Dalos bietet keine chronologische Abhandlung, sondern themenbezogene Tiefenbohrungen, die das Ausmaß der „Entrechtung der innenpolitischen Gegner“ deutlich machen und die Effektivität und Skrupellosigkeit zeigen, mit der dabei vorgegangen wird. Das Fazit kann nur lauten: Orban muss gestoppt werden. Eine Diktatur in ihrer Mitte kann sich die Europäische Union nicht leisten.
Franziska Davies / Katja Makhotina: Offene Wunden Osteuropas. Reisen zu den Erinnerungsorten des Zweiten Weltkriegs

Beim Aufstand im Jüdischen Ghetto Warschaus 1943 und dem Warschauer Aufstand der Polnischen Heimatarmee 1944 geht in der hiesigen Erinnerungskultur doch einiges durcheinander. Die Schauplätze des Holocaust in der Ukraine kennt kaum jemand; von Belarus und Litauen ganz zu schweigen. Auschwitz ist zum Zentralbegriff der deutschen Verbrechen geworden, doch was ist mit Belzec und Majdanek? Und was mit Stalin- und Leningrad? Das Buch von Davies und Makhotina, dem eine breite Leser:innenschaft zu wünschen ist, leistet Bildungsarbeit im besten Sinne.
Steffen Dobbert: Ukraine verstehen. Geschichte, Politik und Freiheitskampf

Die Länder-Verstehen-Bücher des Klett-Cotta-Verlags lohnen fast immer, sind jedoch in der Regel recht dickleibig. Hier nun lediglich knapp zweihundert, schon ganz unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges geschriebene Seiten. Freiheitskampf als Grundthema der ukrainischen Geschichte. Wer auf der Suche nach einer konzisen Alternative zu den Standardwerken von Andreas Kappeler und Serhii Plokhy ist, der wird hier fündig. Mehr HIER.
Nicolas Fromm: Katar. Sand, Geld und Spiele

Die absolute Monarchie Katar ist kleiner als Schleswig-Holstein und hat knapp 2,7 Millionen Einwohner:innen – davon sind gerade einmal 10% (!) katarische Staatsangehörige. Der Rest sind zumeist Arbeitsmigrant:innen. Welchen Unterschied die somit noch nicht einmal 270.000 Kataris für das Weltgeschehen bedeuten können, zeigt die Berichterstattung der letzten Monate im Zuge der Fußball-WM. Nicolaus Fromm spannt einen etwas weiteren Bogen und informiert dabei gründlich und umfassend über ein Land, das hierzulande über den Sport hinaus wohl in den Nachrichten bleiben wird – als Gaslieferant.
Matthias Heine: Kaputte Wörter? Vom Umgang mit heikler Sprache

Nach dem instruktiven und wegweisenden Vorgänger „Verbrannte Wörter“ (2019) nun also die „Kaputten Wörter“ – allerdings mit Fragezeichen. Übersichtlich gegliedert jeweils in Ursprung, Gebrauch, Kritik und Einschätzung lesen wir uns durch „Asylant“, „Eskimo“, „Hasenscharte“ oder „Rasse“ und allein das Unbehagen, das der Rezensent bei der bloßen Wiedergabe dieser Wörter verspürt, zeigt, dass das Thema Sprache von dringlicher Relevanz ist und bleibt.
Jürgen Kaube / André Kieserling: Die gespaltene Gesellschaft

Ist die deutsche Gesellschaft gespalten? Kurze Antwort: Nein. Lange Antwort: Das Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling. Die beiden sehen eher eine gewisse „Angstlust“ beim Publikum und gehen der Frage nach, warum das bei den Deutschen so ist. Dabei hat das Buch gewisse Längen, bleibt jedoch mit seiner Grundaussage für den aktuellen Diskurs ungemein wichtig. Stichwort: False Balancing.
Michael Sommer: Dark Rome: Das geheime Leben der Römer & Alle Wege führen nach Rom. Die kürzeste Geschichte der Antike


Ein Doppel-Wumms der anderen Art: 2022 hat der Oldenburger Althistoriker Michael Sommer mit „Dark Rome“ nicht nur einen Schlüssellochreport und Beststeller über die alten Römer vor-, sondern mit einer „kürzesten Geschichte der Antike“ auch gleich noch eine meisterhafte Synthese nachgelegt. So wird Alte Geschichte erlebbar, was auch an den zahlreichen aktuellen Bezügen liegt, die Sommer immer wieder einzuflechten vermag.
Natan Sznaider: Fluchtpunkte der Erinnerung. Über die Gegenwart von Holocaust und Kolonialismus

Eine hochaktuelle, wenn auch nicht ganz leichte Lektüre: Ausgehend von der Debatte über die Schriften Achilles Mbembes, dessen Unterstützung der BDS-Bewegung, seiner Bezeichnung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern als „Apartheid“ und allgemein der Frage, ob und wie antisemitisch all das ist, analysiert Sznaider das erinnerungspolitische Verhältnis von Holocaust und Kolonialismus anhand ausgewählter Biografien (unter anderem Karl Mannheim, Hannah Arendt, Claude Lanzmann, Edward Said).
Wolfgang Templin: Revolutionär und Staatsgründer. Józef Pilsudski – eine Biografie

Was heute die Beschwichtigung deutscher Intellektueller gegenüber der Ukraine ist („Bloß nicht Putin reizen!“), war in den 1980er Jahren die Beschwichtigung gegenüber den Bürgerrechtler:innen der Solidarność in Polen („Bloß nicht die Sowjets reizen!“). Grund genug, sich mehr mit unserem östlichen Nachbarland zu befassen. Dabei gerät zwangsläufig der „Staatsgründer“ des modernen Polen in den Blick. Wolfang Templin erzählt Pilsudskis Leben anschaulich und spannend wie einen Roman – ohne dabei in eine Hagiographie zu verfallen.
Thomas Urban: Versteller Blick. Die deutsche Ostpolitik

Thomas Urban erklärt hier nochmal alles wichtige zu Russland, der Ukraine, Polen und Deutschland. Wer nur ein einziges Buch zum Themenkomplex zur Hand nehmen möchte, ist mit diesen knapp 200 Seiten bestens bedient. Und wer dann. Urbans luzide formulierten Essay über deutsche Fehlwahrnehmungen gelesen hat, der versteht die Welt ein wenig mehr.




Hinterlasse einen Kommentar